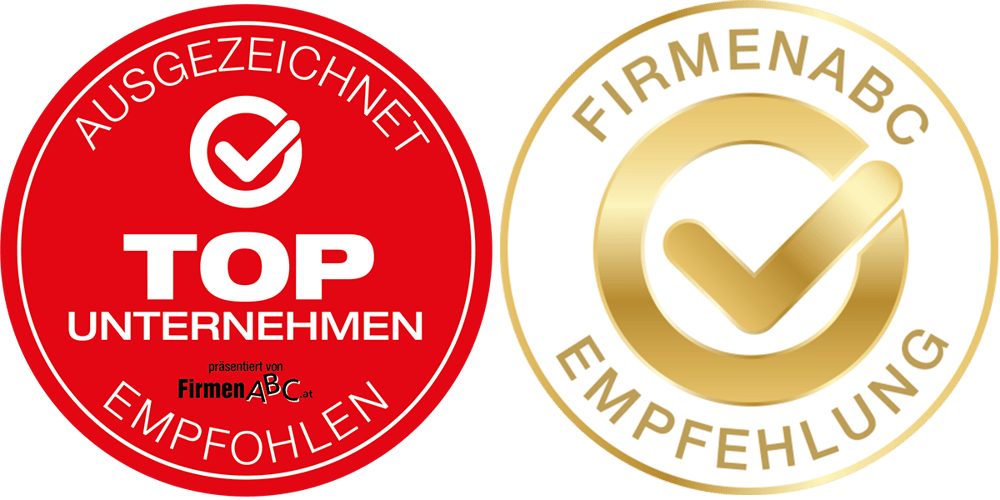Effiziente Heizwerkoptimierung dank professioneller Kesselwärter-Ausbildung: Ein Erfolgsbeispiel mit beeindruckenden Ergebnissen
In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen ein spannendes Fallbeispiel aus der Praxis vorstellen, das eindrucksvoll zeigt, wie durch gezielte Optimierungsmaßnahmen und dem entsprechenden Fachwissen unserer Kesselwärter‒Ausbildung signifikante Einsparungen im Betrieb eines Biomasse‒Heizwerks erzielt werden können.
Dabei handelt es sich um den Betrieb einer 1600 kW KOHLBACH‒Feuerung, die insbesondere im Sommer mit geringer Teillast betrieben wird. Die Ausgangssituation war unbefriedigend, da durch einen hohen Restsauerstoffgehalt im Abgas der nachgeschalteten Rauchgaskondensationsanlage die notwendige Wirtschaftlichkeit fehlte. Doch mit den richtigen Anpassungen und dem nötigen Know‒how konnte der Kesselwirkungsgrad auf beeindruckende 90% gesteigert, die Rauchgaskondensation in Gang gebracht und am Ende sogar eine Brennstoffeinsparung von rund 20% erreicht werden. In diesem Beitrag erhalten Sie einen tiefen Einblick in den Prozess, in die technischen Hintergründe und vor allem in die Aspekte, die eine solide Kesselwärter‒Ausbildung so unverzichtbar machen.
Die verschiedenen Schritte sahen so aus:
Ausgangssituation
Das hier beschriebene Biomasse‒Heizwerk verfügt über eine 1600 kW starke Feuerung des Herstellers KOHLBACH. In den Sommermonaten sank die erforderliche Heizlast erheblich, sodass die Anlage über längere Zeiträume nur noch mit rund 400 kW – also in deutlich reduzierter Teillast – betrieben wurde. Dieser Betrieb mit Teillast ist in vielen Heizwerken nicht unüblich, da die Wärmeabnahme, beispielsweise für die Fernwärme, jahreszeitlich starken Schwankungen unterliegt. Gerade in den warmen Monaten wird meist deutlich weniger Heizenergie benötigt, was für manche Anlagen zu Herausforderungen führt.
Die Herausforderung: Hoher Restsauerstoffgehalt und fehlende Erträge in der Rauchgaskondensation
Ein wesentliches Problem bei der beschriebenen Anlage war der hohe Restsauerstoffgehalt im Rauchgas von rund 14%. Dieser Wert deutet auf einen erhöhten Verbrennungsluftüberschuss hin. Warum ist das problematisch? Nun, bei zu viel zugeführter Verbrennungsluft und gleichzeitig geringer Last sind die Abgastemperaturen in einem Bereich, in dem eine nachgeschaltete Rauchgaskondensationsanlage unter Umständen nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeiten kann. Die Folge: Es tritt keine (oder nur eine unzureichende) Rauchgaskondensation auf – ein wichtiger Teil der Energie wird buchstäblich in Form warmer Abgase „zum Schornstein hinausgeblasen“.
So lag der Kesselwirkungsgrad vor der Optimierung nur bei etwa 83%. Das entspricht zwar in vielen Fällen dem akzeptablen Standard, lässt aber gleichzeitig Spielraum für Verbesserungen. Und genau diese Verbesserungen hatte man sich zum Ziel gesetzt. Außerdem war die Ausbeute in der Rauchgaskondensationsanlage gleich null (0%). Damit wurden Potenziale zur Energiegewinnung aus den Rauchgasen überhaupt nicht genutzt.
Die Optimierung: Schritt-für-Schritt zur besseren Kesseleffizienz
Die beschriebenen Maßnahmen kamen nicht zufällig zustande, sondern resultierten aus einem gezielten Mess- und Analysesystem, das von uns innerhalb eines Tages durchgeführt wurde.
1. Vorbereitung für die Verbrennungsluftmessungen
Der erste Schritt bestand darin, den Verbrennungsluftbedarf genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei wird unterschieden zwischen Primärluft und Sekundärluft:
- Primärluft: Diese Luft wird direkt unter das Brennstoffbett (meist Holz, Hackschnitzel oder andere Biomasse) geleitet. Sie ist maßgeblich für die Trocknung und das Anzünden des Brennstoffes verantwortlich und beeinflusst den Glutstock.
- Sekundärluft: Diese Luft wird oberhalb des Brennstoffbetts zugeführt, um das entstehende Holzgas vollständig zu verbrennen und schädliche Rauchgase zu minimieren.
Um die Luftmengen exakt zu bestimmen, bedurfte es einer systematischen Messreihe. Hier zeigen sich die Vorteile fundierter Fachkenntnisse: Nur wer weiß, wie man Messgeräte korrekt anbringt, Kalibrierungsfaktoren beachtet und die richtigen Schlüsse aus den angezeigten Messwerten zieht, kann die Anlage effizient einstellen.
2. Ermittlung der Primär‒ und Sekundärluftmengen
In einem weiteren Schritt wurden die Ist-Zustände der Primär- und Sekundärluftmengen gemessen. Anhand dieser Werte war es möglich, das Zusammenspiel zwischen Luftmenge, Temperatur und Abgasströmung besser abzustimmen. Ein erfahrener Kesselwärter erkennt schnell, ob beispielsweise zu viel Sekundärluft zugeführt wird, sodass der Restsauerstoff im Abgas ansteigt und die Abgase verhältnismäßig kalt bleiben.
Ziel war es, den Restsauerstoffgehalt im Abgas zu senken, da eine niedrige Sauerstoffkonzentration im Rauchgas ein Zeichen dafür ist, dass das Verhältnis von Luft und Brennstoff optimiert wurde. Gleichzeitig sollte die Abgastemperatur soweit angepasst werden, dass die Rauchgaskondensationsanlage wieder in Betrieb gehen kann. In einer gut justierten Anlage kann man sich das zunutze machen, indem man möglichst viel Wärme aus den Abgasen zurückgewinnt und so den Brennstoffwirkungsgrad steigert.
3. Rauchgas kondensiert bei geringem Sauerstoffgehalt
Da das Abgas mit reduzierter Sauerstoffmenge heißer ist und sich in gewissen Temperaturbereichen dichter an den Taupunkt des Wasserdampfes im Rauchgas annähert, kann nun Wärme durch Kondensation zurückgewonnen werden. Bei zu hohem Restsauerstoffgehalt (und damit üblicherweise auch zu hohen Luftmengen) war dieser Effekt vorher ausgeschlossen.
In diesem Fallbeispiel zeigte sich, dass der Restsauerstoff von 14% nach unten gedrückt werden konnte, woraufhin sich ein für die Rauchgaskondensation geeigneter Bereich einstellte. Sobald die Temperaturverhältnisse und die Taupunktsituation stimmten, begann das Wasser im Rauchgas zu kondensieren. Dieser Kondensationsprozess setzt eine erhebliche Menge an Wärmeenergie frei, die zuvor verloren ging. Genau dort schlummern immense Einsparungspotenziale.
4. Brennstoffbett nach vorne gezogen
Eine weitere Feststellung nach den vorgenommenen Messungen und Einstellungen war, dass durch die geringeren Verbrennungsluftmengen das Brennstoffbett weiter nach vorne gezogen werden konnte. Das bedeutet, dass der Brennstoff homogener abbrennen kann und sich keine „toten“ Zonen bilden, in denen das Material lediglich schwelt oder nicht richtig ausgenutzt wird. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Glutstock stabiler bleibt und die Verbrennungsqualität besser wird – was sich letztlich in verbesserten Emissionswerten und höherer Effizienz niederschlägt.
Die Ergebnisse: Erstaunliche Zahlen und deutliche Einsparungen
Nachdem die Anlage sorgfältig eingestellt, gemessen und ausgewertet wurde, ließen die Ergebnisse nicht lange auf sich warten. Gleich mehrere Kennzahlen spiegeln den Erfolg der Maßnahmen wider:
- Kesselwirkungsgrad: Er stieg von ehemals 83% auf 90% an. Dies ist eine beachtliche Steigerung, die sich auf den Brennstoffeinsatz und die laufenden Betriebskosten gleichermaßen positiv auswirkt.
- Rauchgaskondensation: Vorher bei 0%, nun konnte eine Ausbeute von 13% erreicht werden. Mit anderen Worten: Jetzt wird ein signifikanter Teil der in den Rauchgasen vorhandenen Wärme über die Kondensationsanlage zurückgewonnen. Diese zusätzliche Energie steigert den Gesamtnutzungsgrad enorm.
- Brennstoffeinsparung im Teillastbetrieb: Durch die Optimierung konnte eine Einsparung von etwa 20% beim Brennstoffverbrauch realisiert werden. Wenn wir hier von Holz oder Biomasse sprechen, kann das, je nach Brennstoffpreis, eine erhebliche Kostenreduktion bedeuten. In Zahlen ausgedrückt: Zwischen 10.000€ und 15.000€ weniger Ausgaben pro Jahr, je nach Schwankungen bei den Brennstoffkosten und Lastverhältnissen.
Damit steht fest, dass die anfänglich aufgewendete Zeit und Investition in Messtechnik, Feinabstimmung und Expertenschulungen sich mehrfach auszahlen. Die jährlichen Betriebskosten sinken, und die Anlage ist wesentlich umweltfreundlicher unterwegs, weil mehr Energie aus dem eingesetzten Brennstoff gewonnen wird.

Rolle einer soliden Kesselwärter‒Ausbildung
Die hier beschriebenen Optimierungen sind kein Zufall und auch kein reines „Trial and Error“. Dahinter steckt ein fundiertes Know‒how über:
- Verbrennungsabläufe in Biomassekesseln
- Physikalische Grundlagen der Rauchgaskondensation
- Bedienung und Interpretation von Messinstrumenten
- Einstellmechanismen für Primär‒ und Sekundärluft
- Praxiswissen über den Aufbau und die Funktionsweise verschiedener Kessel‒ und Feuerungstypen
All diese Wissensbereiche werden in einer Kesselwärter‒Ausbildung vermittelt, die speziell auf den Betrieb von Biomasseheizwerken bzw. Biomasse‒Heizkraftwerken zugeschnitten ist.
Warum ist das so wichtig? Der Kesselwärter – oder generell das technische Personal – entscheidet maßgeblich darüber, wie effizient eine Anlage betrieben wird. Ein paar Prozentpunkte beim Kesselwirkungsgrad mögen auf den ersten Blick unspektakulär erscheinen. Im Dauerbetrieb eines Heizwerks über mehrere Jahre führen aber bereits 2–3 Prozentpunkte mehr an Wirkungsgrad zu erheblichen finanziellen Vorteilen und einem gesteigerten Wettbewerbsvorteil. Ganz zu schweigen von den ökologischen Vorteilen, da jeder eingesparte Schüttraummeter Hackgut weniger Ressourcen verbraucht und weniger Emissionen freisetzt.
In einer guten Kesselwärter‒Ausbildung lernt man genau die Kniffe, um aus jeder Anlage das Maximum herauszuholen, ohne sie dabei zu überlasten oder ihre Lebensdauer zu verkürzen. Man versteht, wie sich Restsauerstoffmessungen interpretieren lassen, wie Abgastemperaturen in Bezug zum Verbrennungsprozess stehen, und welche Maßnahmen zur Vermeidung von zu hohem Luftüberschuss sinnvoll sind.
Ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit
Abseits der technischen Details spielt natürlich die Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle. Wie beschrieben, summieren sich die Vorteile der Optimierungsmaßnahmen auf mehrere Zehntausend Euro pro Jahr. Dies ist besonders für Betriebe interessant, die auf den wirtschaftlichen Erfolg angewiesen sind. Denn jede Investition in Messtechnik, Personalqualifizierung oder Anlagenaufrüstung muss sich lohnen.
Die Amortisationszeiten für derartige Optimierungen können oft überraschend kurz sein. Das gilt insbesondere dann, wenn bereits eine (bislang nicht optimal genutzte) Rauchgaskondensationsanlage vorhanden ist. Mit der richtigen Einstellung der Luftmengen und einer Verringerung des Sauerstoffanteils im Abgas kann man den Sprung von 0% Kondensation auf über 10% schnell erreichen, was direkt zu einer höheren Effizienz führt.
Auch das Thema Brennstoffpreise ist nicht zu unterschätzen. Gerade in Zeiten schwankender Energiekosten kann ein um 20% geringerer Brennstoffverbrauch den Unterschied ausmachen, ob ein Betrieb Gewinne erzielt oder kostendeckend arbeitet.
Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltschutz
Im Kontext eines Biomasseheizwerks spielt der Umweltschutz eine übergeordnete Rolle. Biomasse gilt als weitgehend klimaneutraler Energieträger, sofern sie nachhaltig bewirtschaftet und genutzt wird. Doch auch bei der Biomasseverbrennung sind Emissionen wie Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub von Bedeutung. Eine gute Ausbildung und Einstellung der Anlage sorgt nicht nur für höhere Effizienz, sondern oft auch für niedrigere Emissionen.
Wenn die Verbrennung vollständig und kontrolliert abläuft, entstehen weniger Schadstoffe. Gleichzeitig kann die Anlage für eine gewisse Zeit mit geringem Luftüberschuss betrieben werden, was die Abgastemperaturen im gewünschten Bereich hält. Somit ist die Reduktion des Restsauerstoffgehalts im Abgas nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern auch ein erheblicher Vorteil in Sachen Umweltschonung.
Blick in die Praxis: Unser YouTube-Video
Falls Sie mehr über die Umsetzung, die Details der Umbauten und die praktische Vorgehensweise erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen unser YouTube-Video, in dem wir die Situation und die Optimierungsschritte anschaulich erklären.
In diesem Video zeigen wir die einzelnen Phasen der Messung, der nachfolgenden Anlageneinstellung. So können Sie selbst einen Eindruck davon gewinnen, welche Stellschrauben man in einem Heizwerk drehen muss, um am Ende ein solch eindrucksvolles Ergebnis zu erzielen.
Warum die Ausbildung zum Kesselwärter so wichtig ist
Eine gute Kesselwärter‒Ausbildung ist enorm wertvoll, denn sie bildet das Fundament für all diese Optimierungsschritte. Wer sich intensiv mit der Technik von Biomasseheizwerken auseinandersetzt, lernt:
- Verbrennungstechnische Grundlagen: Wie funktioniert die Pyrolyse? Wie entsteht Holzgas und warum ist dessen vollständige Verbrennung so wichtig?
- Kessel‒ und Feuerungstechnologien: Welche Kesselbauarten gibt es? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Rostfeuerungen?
- Mess‒ und Regeltechnik: Wie liest man Abgasmessgeräte ab und wie justiert man die Luftklappen, um den Sauerstoffgehalt präzise zu steuern?
- Sicherheit und Verantwortung: Als Kesselwärter trägt man eine hohe Verantwortung für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Allein die Überwachung und Steuerung im alltäglichen Betrieb ist anspruchsvoll und erfordert Routine.
- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit: Der Kesselwärter sollte wissen, wie sich Brennstoffverbrauch und Emissionen minimieren lassen, ohne Einbußen bei der Versorgungssicherheit hinzunehmen.
Gerade heute, wo der Energiebereich einem steten Wandel unterworfen ist und Nachhaltigkeit in aller Munde ist, lohnt sich diese Ausbildung mehr denn je. Die Nachfrage nach kompetenten Kesselwärtern und Fachleuten, die Biomasseanlagen effizient betreiben können, nimmt stetig zu.
Zusammenfassung:
Das hier beschriebene Beispiel verdeutlicht, wie wichtig eine professionelle Herangehensweise für den Betrieb eines Biomasse-Heizwerks ist. Durch das Absenken des Restsauerstoffgehalts im Rauchgas und eine präzise Einstellung von Primär- und Sekundärluft konnte:
- Der Kesselwirkungsgrad von 83% auf 90% gesteigert werden,
- Die Rauchgaskondensation von 0% auf 13% hochgefahren werden,
- Im Teillastbetrieb eine Brennstoffeinsparung von etwa 20% – das bedeutet eine Kostenersparnis von ca. 10.000€ bis 15.000€ pro Jahr.
All dies ist in großem Maße auf die fundierte technische Expertise zurückzuführen, die man in einer Kesselwärter-Ausbildung erwirbt. In Zeiten steigender Energiepreise und einem klaren Bekenntnis zu erneuerbaren Energien ist es relevanter denn je, das Potenzial moderner Biomasseanlagen voll auszuschöpfen. Nicht nur der Geldbeutel, sondern auch die Umwelt profitiert von diesen Optimierungsmaßnahmen.
Wer sich genauer für das Thema interessiert, findet in unserem oben verlinkten YouTube‒Video weiterführende Einblicke in die Umbau- und Einstellmaßnahmen dieser Anlage. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Möglichkeiten einer Ausbildung zum Kesselwärter: Dieses umfangreiche Know-how öffnet viele Türen und gibt Ihnen die Fähigkeit, nicht nur im eigenen Betrieb, sondern auch als Dienstleister in anderen Biomasseheizwerken umfassende Optimierungen voranzutreiben.
Sollten Sie bereits im Betrieb eines Biomasse-Heizwerks tätig sein oder eine solche Anlage planen, empfiehlt es sich dringend, jemanden mit der entsprechenden Ausbildung ins Boot zu holen. Die potenziellen Einsparungen und Effizienzsteigerungen sind beeindruckend, wie unser Beispiel zeigt. Durch systematische Messungen, präzise Auswertung und anschließende Korrekturen der Verbrennungsluftzufuhr lässt sich der Restsauerstoffgehalt senken und die Rauchgaskondensation aktivieren. So wird aus einer durchschnittlich laufenden Anlage schnell ein hoch effizienter und ressourcenschonender Betrieb.
Abschließende Worte
Die Technik rund um Biomasseanlagen mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, doch genau darin liegt der Reiz und das Potenzial. Mit dem richtigen Wissen – vermittelt zum Beispiel in einer Kesselwärter-Ausbildung – sind Sie in der Lage, immense Effizienzgewinne zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Anlage auszuschöpfen. Und wer einmal erlebt hat, wie der Kesselwirkungsgrad in die Höhe schnellt und die Brennstoffkosten deutlich sinken, der wird das Thema Heizwerkoptimierung nicht mehr aus den Augen verlieren.
Falls Sie mehr über unsere Ausbildungsangebote, Kesselwärter-Lehrgänge oder weitere Optimierungsbeispiele erfahren möchten, setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Steigerung der Effizienz Ihres Heizwerks behilflich zu sein und Ihnen zu zeigen, wie Sie aus Ihrer Anlage das Maximum herausholen können – für Ihren wirtschaftlichen Erfolg und für eine umweltschonende Zukunft.