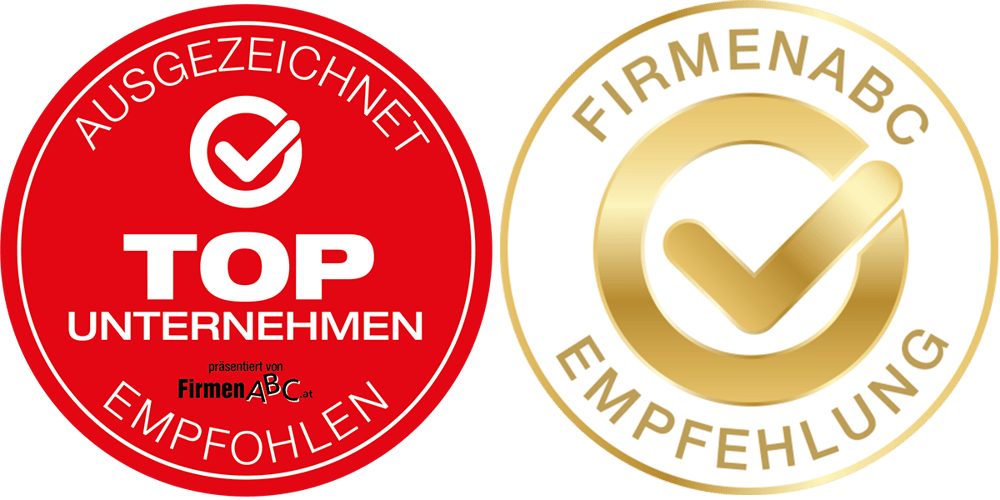Warum Optimierungen in Biomasse-Heizwerken immer wichtiger werden
Die Nutzung von Biomasse zur Erzeugung von Wärme und Strom hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Standbein der Energiewende entwickelt. Viele Kommunen setzen auf Fernwärme aus Biomasseheizwerken, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Doch wie bei jeder technischen Anlage kommt es im Betriebsalltag auch hier immer wieder zu Problemen: schwankende Brennstoffqualitäten, hohe thermische Belastungen, unerwartete Stillstände oder kostenintensive Reparaturen.
In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf ein Umbauprojekt in einem Heizwerk mit zwei Stufenrostfeuerungen mit jeweils 12 MW Kesselleistung. Ursprünglich sorgte ein sehr trockener Brennstoff dafür, dass die Temperaturen in der Brennkammer gefährlich anstiegen. Diese hohe termische Belastung führte zu Schlackenbildung, Reparaturkosten von 200.000 € je Anlage und Ratlosigkeit bei den Betreibern. Erst ein gründlicher Analyseprozess (Bilanzierung, Leistungsfahrt) sowie die anschließende Umrüstung der primären Abgaszirkulation schafften Abhilfe. Heute liegen die Temperaturen am Rost als auch in der Nachbrennkammer deutlich unter 950°C statt wie zuvor bei über 1100°C.
Der Fall macht deutlich, wie unverzichtbar eine fundierte Betrachtung des Anlagenbetriebs und das nötige Fachwissen sind. Vor allem die Rolle des Kesselwärters rückt dabei in den Mittelpunkt: Gut geschultes Personal ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und nachhaltige Lösungen einzuleiten.
Durchgeführte Schritte der Heizwerkoptimierung:
Ausgangssituation
Übermäßige Hitze und steigende Kosten
In dem hier behandelten Beispiel war das Heizwerk seit einiger Zeit in Betrieb und versorgte ein lokales Fernwärmenetz. Die zwei baugleichen Stufenrostfeuerungen – jeweils für 12 MW ausgelegt – zeigten jedoch zunehmend Auff�älligkeiten:
Extrem trockener Brennstoff:
Der verwendete Holz‒Brennstoff hatte sehr niedrige Feuchtewerte. Trockenes Holz bietet zwar prinzipiell einen höheren Energiegehalt, kann aber bei unzureichender Regelung für überhöhte Verbrennungstemperaturen sorgen.
- Brennkammertemperaturen von über 1150°C: Solche hohen Temperaturen klingen zunächst nach Effizienz und guter Auslastung. Tatsächlich waren sie jedoch schädlich: Der Rost und der Feuerraum wurden stark beansprucht und der Verschleiß erhöhte sich in bedenklichem Maße.
- Schlackenbildung: Auch Schlacke entsteht häufig durch zu hohe Verbrennungstemperaturen in Kombination mit bestimmten Aschebestandteilen. Sobald sich Schlacken im Brennraum bilden, leidet die Wärmeübertragung, die Rostbewegung wird gestört und es können Beschädigungen in der Brennkammer auftreten.
- Hohe Reparaturkosten: Die Folgen machten sich mit Reparaturrechnungen von rund 200.000 € je Anlage bemerkbar. Besonders problematisch war, dass unplanmäßige Stillstände hinzukamen. Jedes Abfahren und Wiederanfahren der Anlagen verursacht zusätzliche Kosten und Aufwand für das Personal.
- Ratlosigkeit beim Betreiber: Das Team vor Ort hatte bereits verschiedene Maßnahmen ausprobiert, darunter Veränderungen bei Luftmengen oder im Brennstoffmanagement. Trotzdem blieb das zentrale Problem: Die Temperaturspitzen wollten sich nicht unter Kontrolle bringen lassen. Auch das Flammenbild blieb unruhig, was auf einen turbulenten Verbrennungsverlauf hindeutete.
In Summe war klar, dass es einer strategischen Lösung bedurfte, um diese für den Anlagenbetrieb gravierenden Probleme zu beseitigen. Nur so ließen sich auf Dauer die Kosten drücken, Ausfälle vermeiden und die Effektivität steigern.
Analysephase:
Anlagenbilanzierung und Leistungsfahrt der Kesselanlagen
Um zu verstehen, warum genau die Temperaturen so weit in den kritischen Bereich stiegen, bedurfte es einer soliden Datengrundlage.
Zwei wesentliche Schritte standen am Anfang:
1. Anlagenbilanzierung

Hierbei handelt es sich um eine detaillierte Erfassung aller Energie- und Stoffströme. Das Ziel ist, herauszufinden, wo Wärme erzeugt, übertragen oder verloren geht und wie die Zusammensetzung der Rauchgase beschaffen ist. In der praktischen Umsetzung werden Messungen an mehreren Punkten der Anlage durchgeführt, beispielsweise:
- Temperaturmessungen im Feuerraum und in den Rauchgaskanälen
- Luft- und Abgasvolumenströme
- Brennstofffeuchte und Heizwert
- Druckverhältnisse und Sauerstoffgehalt
Diese Daten werden in einem Modell zusammengeführt, das den aktuellen Zustand der Anlage präzise abbildet. Auf dieser Grundlage ist erkennbar, welche Stellschrauben sich lohnen. So ließen sich auch die Einsatzgrenzen der Anlage ermitteln: Wo ist das thermische Maximum? Welche Bereiche überlasten das System?
2. Leistungsfahrt

Ergänzend erfolgte eine Leistungsfahrt, bei der die Anlage über einen längeren Zeitraum ganz gezielt unter maximaler, mittlerer und geringer Teillast gefahren wurde. Dabei misst man kontinuierlich wichtige Kennwerte, um zu sehen, wie sich Temperatur und Verbrennungsluftbedarf in unterschiedlichen Lastsituationen verhalten.
In diesem Prozess zeigte sich zum Beispiel, dass die extremen Temperaturspitzen nicht nur bei Volllast, sondern auch im mittleren Lastbereich auftraten, sobald der Brennstoff besonders trocken war. Das turbulente Flammenbild war ein Indiz dafür, dass der vorhandene Sauerstoffüberschuss zu hoch war und die Abgasrückführung nicht ausreichte, um diese überschießende Verbrennungsreaktion einzudämmen.
Umbau: Fokus auf die primäre-Abgasrezirkulation
Auf Basis der Analyseergebnisse stand fest: Die primäre Luftzufuhr im Rostbereich musste angepasst werden, um die Brennkammertemperaturen nachhaltig in den Griff zu bekommen.
Der Schlüssel war die primäre‒Abgaszirkulation.
1. Idee und Konzept

Die Rezirkulation von Abgas, das bereits durch den Kessel geflossen ist, kann in vielen Verbrennungsanlagen dazu beitragen, die Temperaturen im Feuerraum zu steuern. Da das rückgeführte Abgas einen geringeren Sauerstoffgehalt und eine bereits reduzierte Temperatur aufweist, „verdünnt“ es die Verbrennungsluft und bremst so die Hitzeentwicklung.
- Reduzierter Sauerstoffanteil: Dies senkt die Geschwindigkeit der Verbrennungsreaktion.
- Thermische Entlastung: Das zurückgeführte Gas ist zwar noch warm, aber nicht mehr so heiß wie die Flammen selbst. So werden Temperaturspitzen abgemildert.
- Homogenere Verbrennung: Die Flamme wird ruhiger, da plötzliche Sauerstoff- und Temperatursprünge besser ausgeglichen werden.
2. Umbauplanung

Obwohl das Prinzip einfach klingt, erfordert ein solcher Umbau eine sorgfältige Planung. Schließlich greift man in einen Kernprozess der Anlage ein. Der Rohrleitungsbau, die Ventiltechnik und vor allem die Steuerung der Volumenströme müssen exakt aufeinander abgestimmt sein:
- Dimensionierung: Wie viel Abgas wird rückgeführt, um optimale Bedingungen zu erzielen?
- Strömungstechnik: Wo genau wird das Abgas unter den Rost eingeleitet, damit es sich möglichst gleichmäßig verteilt?
- Regelung: In welcher Lastsituation wird wie viel Abgas zugeführt, damit die Anlage weder „erstickt“ noch erneut zu heiß wird?
Wir wählten eine Lösung, bei der ein bestimmter Anteil des Kesselabgases über zusätzliche Leitungen und Rauchgasklappen zurück in den Brennraum geleitet wurden. Für den Betreiber bedeutete dies eine definierte Investition, verbunden mit einem kurzen, geplanten Anlagenstillstand für die Montage und Inbetriebnahme.
Ergebnis und Erfolgsauswertung
Deutlich geringere Temperaturen
Nach Abschluss des Umbaus und einer kurzen Einfahrphase zeigten die Messdaten und der Anlagenbetrieb sehr eindrücklich, wie stark sich eine derartige Maßnahme auswirken kann:
- Beruhigtes Flammenbild
Wo früher ein unruhiger und turbulenter Feuerschein sichtbar war, herrschte nun eine gleichmäßigere, kontrolliertere Verbrennung. Dies deutet auf eine homogenere Mischung von Sauerstoff und brennbaren Gasen hin.
- Rosttemperaturen deutlich unter 950°C
Im Vergleich zu den früheren Werten von mehr als 1100°C ist das eine beachtliche Verbesserung. Die Brennkammer wird weniger belastet, die Lebensdauer steigt und der Wartungsaufwand sinkt.
- Kaum noch Schlackenbildung
Da die Temperaturspitzen ausblieben, reduzierte sich die Schlacke massiv. Für das Betriebspersonal bedeutet dies einen geringeren Reinigungsaufwand. Zudem sinkt das Risiko von mechanischen Beschädigungen und Anlagenausfällen.
- Weniger Reparaturkosten
Reparaturen am Feuerraum und Rost erforderten zuvor Ausgaben in Höhe von rund 200.000 € je Anlage pro Jahr. Nun ließ sich ein Großteil dieser Kosten vermeiden – wodurch die Investition in den Umbau sich sehr schnell amortisiert hatten.
Insgesamt verbesserte sich die Zuverlässigkeit und Effizienz der Anlage signifikant. Betreiber und Team zogen ein durchweg positives Fazit und lobten insbesondere die fundierte Vorgehensweise: Von der Bilanzierung über die Leistungsfahrt bis zur erfolgreichen Umsetzung ging alles Hand in Hand.
Die Rolle des Kesselwärters:
Know‒how für langfristige Betriebssicherheit
Ein solches Projekt verdeutlicht, wie komplex und fein abgestimmt eine Stufenrostfeuerung oder allgemein ein Biomasse‒Kraftwerk funktionieren muss. Technische Optimierungen und Umbauten sind eine Seite – die andere Seite ist das geschulte Personal, das diese Anlagen täglich überwacht und wartet.
Kesselwärter sind Spezialisten, wenn es um den sicheren und effizienten Betrieb von Kesselanlagen geht. Sie besitzen das Wissen, relevante Parameter laufend zu kontrollieren, Abweichungen rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. In unserer Kesselwärter‒Ausbildung erwirbt man genau die Kompetenzen, die in der Praxis oft den entscheidenden Unterschied machen:
- Erkennen von Störungen im Feuerraum
- Interpretation von Messwerten (z. B. Temperatur, Druck, Rauchgaszusammensetzung)
- Verständnis von Verbrennungsprozessen und Brennstoffqualitäten
- Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften
Gerade wenn ein Umbau wie die Einführung oder Erweiterung einer Abgasrezirkulation geplant ist, sind tiefgehende Fachkenntnisse Gold wert. Ein Kesselwärter, der die Komplexität des Verbrennungsprozesses kennt, kann unterstützen, die optimalen Einstellungen für die Anlage zu finden. So bleiben die Anlagen in einem Zustand, der wirtschaftlich rentabel, umweltverträglich und sicher ist.

Besonderheiten der Stufenrostfeuerung
Um das beschriebene Umbauprojekt besser zu verstehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf den Aufbau und die Funktionsweise einer Stufenrostfeuerung. Dieses Prinzip kommt in vielen Biomasse‒Heizwerken zum Einsatz, weil es eine robuste und flexible Lösung für feste Brennstoffe bietet:
Mehrere Roststufen
Das Holz wird meist von oben aufgegeben und auf einem geneigten Rost nach unten transportiert. Jede Stufe kann unterschiedliche Luftmengen erhalten, um den Verbrennungsprozess in Abschnitten zu steuern.
- Trocknungsphase
Der Brennstoff trocknet in der oberen Zone aus, bis er seine flüchtigen Bestandteile abgibt und mit der Pyrolyse (Vergasung) beginnt.
- Ausbrandzone
In den unteren Rostbereichen wird der Kohlenstoff im Holz restlos verbrannt. Dabei braucht es ausreichend Sauerstoff, jedoch ohne extreme Hitzeausbrüche.
Treten jedoch Abweichungen auf – etwa sehr trockener Brennstoff oder eine ungünstige Luftzufuhr –, kann die Temperatur zu stark ansteigen. Schlackenbildung, Materialverschleiß und hohes Emissionsniveau können die Folge sein. Genau hier setzt die Idee einer effektiven Abgasrückführung an, die den Energieeintrag dämpft und die Temperatur regelt.
Ausblick: Herausforderungen und Chancen
Biomasseheizkraftwerke spielen in Zeiten der Energiewende eine entscheidende Rolle. Ihr Vorteil liegt in der Nutzung von lokal verfügbaren, nachwachsenden Rohstoffen – ein Plus für regionale Wertschöpfung und CO₂-Einsparungen. Gleichzeitig können Betreiber mit bestimmten Problemen konfrontiert werden, wenn zum Beispiel:
- Neue Emissionsgrenzwerte gelten
- Brennstoffqualitäten sich verändern
- Höhere Wirkungsgrade angestrebt werden
- Technische Komponenten an Verschleißgrenzen gelangen
Es ist absehbar, dass weitere Technologien zur Optimierung und Flexibilisierung von Biomasseanlagen aufkommen werden. Dazu können eine bessere Steuerung, neue Rostkonzepte oder verbesserte Rauchgasnachbehandlung zählen. Auch die Digitalisierung wird ihre Spuren hinterlassen: Intelligente Sensorik und Big-Data-Analysen bieten die Chance, Verschleiß oder Fehlfunktionen noch früher vorherzusagen.
Doch egal, wie modern die Technik wird, Fachwissen und praktische Erfahrung bleiben unverzichtbar. Daher ist die Nachfrage nach gut ausgebildeten Kesselwärtern ungebrochen hoch. Wer sich intensiv mit den Grundlagen der Verbrennungstechnik beschäftigt und die Zusammenhänge zwischen Brennstoff, Rostfeuerung, Abgasführung und Steuerung versteht, ist in der Lage, Betriebsprobleme zu vermeiden und Anlagen wirtschaftlich zu optimieren.
Fazit: Warum sich eine ganzheitliche Optimierung lohnt
Das vorgestellte Umbauprojekt zeigt eindrucksvoll, wie stark sich eine präzise geplante technische Änderung auswirken kann. Ausgehend von schwerwiegenden Problemen – überhöhte Brennraumtemperaturen jenseits von 1150°C, Schlackenbildung, enormen Reparaturkosten und hohem Personalaufwand – fand man zu einem nachhaltig verbesserten Anlagenbetrieb, nachdem die primäre-Abgaszirkulation optimiert und umgebaut worden war.
Die Ergebnisse sprechen für sich:
- Temperaturen unter 950°C sorgen für weniger Verschleiß und weniger Schlacke.
- Ein ruhiges Flammenbild fördert die Sicherheit und senkt das Ausfallrisiko.
- Reparatur- und Wartungskosten wurden drastisch reduziert, was die Investition in den Umbau rasch amortisiert.
Wer selbst eine Biomasseanlage betreibt oder plant, profitiert von dieser Art von Projektbericht: Er zeigt, dass nachhaltige Lösungen gefunden werden können, wenn man systematisch vorgeht und die richtigen Fachleute hinzuzieht. Solche Fachleute sind neben Ingenieuren wie uns insbesondere engagierte Kesselwärter, die den Anlagenalltag kennen und mit Umsicht handeln.
Abschließend bleibt zu sagen: Interesse an Weiterbildung, etwa in Form eines Kesselwärter-Lehrgangs, lohnt sich für jeden, der in diesem Umfeld tätig ist. Die Einblicke in technische Zusammenhänge und optimierte Betriebsverfahren haben das Potenzial, spürbare Vorteile für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz zu bringen. Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr über die optimale Fahrweise von Biomasseanlagen erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich unsere angebotenen Seminare und Schulungen genauer anzusehen. Dort erhalten Sie das vertiefte Know-how, um ähnliche Lösungen umzusetzen und sich fit für die Zukunft der erneuerbaren Energien zu machen.