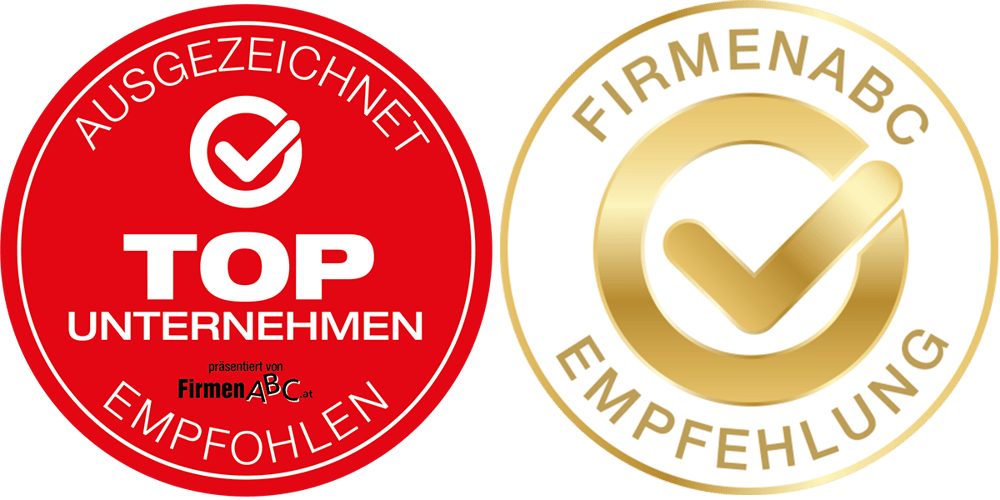Umfassender Überblick zu den Neuerungen
der FAV 2019 und dem EG‒K 2023 für Feuerungsanlagenbetreiber
Gesetzliche Anpassungen und was dahintersteckt
Vor einigen Jahren führten steigende Anforderungen an den Umweltschutz und der Wunsch nach mehr Transparenz im Betrieb von Feuerungsanlagen zur Überarbeitung der Feuerungsanlagenverordnung (FAV). In der FAV 2019 wurden strengere Emissionsgrenzwerte, veränderte Messintervalle sowie neue Dokumentationspflichten verankert. Ergänzend dazu wurde das Emissionsgesetz für Kesselanlagen (EG-K), meist kurz als EG-K 2023 bezeichnet, ebenfalls angepasst.
Zu den wesentlichen Neuerungen gehört die Zusammenführung bestimmter Vorschriften für Dampfkessel und Heizkessel, was sich spürbar auf den Praxisalltag von Anlagen mit Leistungen ab 1 MW Brennstoffwärmeleistung auswirkt. Vor allem Betreiber von Biomasse-Heizkraftwerken, Fernwärme-Anlagen und ähnlichen Kesselanlagen sollten sich intensiv mit den Änderungen auseinandersetzen.

Registrierungspflicht und Dokumentation:
Wer ist betroffen?
Registrierung im edm-Portal
Bereits seit Ende 2019 sind alle Betreiber von Feuerungsanlagen ab 1 MW dazu verpflichtet, ihre Anlagen im edm‒Portal (elektronisches Datenmanagement) zu registrieren. Hintergrund der Regelung ist, dass die Behörde eine bessere Übersicht über die in Betrieb befindlichen Anlagen erhält. Die Registrierung muss stets aktuell gehalten werden, insbesondere bei Änderungen an der Anlage.
- Leistungsbereich: 1–50 MW
- Ausnahme: Anlagen unter 1 MW benötigen keine Registrierung im edm‒Portal, auch wenn sie gemeinsam mit anderen Anlagen betrieben werden, solange der Anlagenverbund insgesamt nicht die 1-MW-Schwelle überschreitet.
Gerade in größeren Biomasseheizwerken oder kombinierten Anlagen, in denen unterschiedliche Kessel (z.B. Ersatzkessel) betrieben werden, ist es wichtig zu prüfen, ob mehrere Kessel gemeinsam die Grenze von 1 MW überschreiten. In diesem Fall müssen sie registriert werden.
Erhöhte Dokumentationspflichten
Mit der FAV 2019 wurde der Fokus auf ordentliche und kontinuierliche Aufzeichnungen ausgeweitet. Für alle Anlagenbetreiber, die der FAV 2019 unterliegen (also üblicherweise ab 1 MW), gilt eine sechsjährige Aufbewahrungspflicht (vormals drei Jahre). Das bedeutet konkret:
- Genehmigungsbescheide und jede Änderung daran müssen lückenlos dokumentiert werden.
- Überprüfungsergebnisse (von wiederkehrenden Messungen, Wartungsberichten etc.) sind aufzuzeichnen.
- Brennstoffqualität und -menge sind genau festzuhalten. Dies betrifft besonders Biomasse, die häufig in Form von Hackschnitzeln oder Pellets eingesetzt wird.
- Fälle von Nichteinhaltung der Auflagen, beispielsweise Grenzwertüberschreitungen oder technische Störungen, müssen detailliert erfasst und die ergriffenen Maßnahmen dokumentiert werden.
Gerade in einem Biomasse-Heizwerk können die Brennstoffqualitäten variieren. Eine penible Dokumentation ist daher nicht nur aus rechtlichen Gründen sinnvoll, sondern hilft auch, eventuelle Probleme rasch zu erkennen (z.B. wenn zu feuchtes oder zu grobes Holz zu Emissionsspitzen führt).
FAV 2019 und EG‒K 2023: Was ändert sich konkret?
Zusammenführung EG‒K und FAV
Früher galten für Dampfkessel gesonderte Grenzwerte und Vorgaben, die teilweise unbefristet in Genehmigungsbescheiden festgeschrieben waren. Durch die Überarbeitung des EG-K 2023 werden nun auch ältere Dampfkessel an die Grenzwerte der FAV 2019 angepasst, und zwar meist ab einer bestimmten Übergangsfrist. Für Anlagen über 5 MW bedeutet dies, dass ab dem 1. Januar 2025 die strengeren Grenzwerte der FAV 2019 eingehalten werden müssen.
Dieser Punkt ist insbesondere für Betreiber größerer Fernwärme-Anlagen oder Biomassekraftwerke relevant, bei denen Dampfkesseltechnologie zum Einsatz kommt. Sobald die Übergangsfrist endet, gelten verbindlich die Werte der FAV 2019 und die zuvor unbefristet genehmigten Werte verlieren ihre Gültigkeit.
Dampfkessel‒Definition: Jetzt ab 110 °C
Eine wichtige Änderung in der Terminologie besagt, dass ein Dampfkessel erst dann als solcher eingestuft wird, wenn er eine Wassertemperatur über 110 °C erreicht. Früher lag die Grenze bei 100 °C.
- Konsequenz: Kessel mit einer zulässigen Wassertemperatur bis einschließlich 110 °C fallen nicht mehr ins EG-K, sondern zählen zur FAV 2019.
- Praxisbeispiel: Ein Heizkessel, der bislang knapp über 100 °C Wasser führt, wird womöglich jetzt als „Heißwasserkessel“ gemäß FAV betrachtet und muss die damit verbundenen Emissionsgrenzwerte einhalten.
Neue Emissionsgrenzwerte und Bezugs‒Sauerstoffgehalte
Werden die Grenzwerte zwischen FAV 2011 und FAV 2019 verglichen, fällt auf, dass einige Werte umgerechnet werden müssen, da der Bezugs-Sauerstoffgehalt bei festen Brennstoffen (z.B. Holz) von vormals 11 % auf 6 % gesenkt wurde. Zur Umrechnung gilt in etwa ein Faktor von 1,5. Damit kann sich beispielsweise der Staubgrenzwert (in mg/Nm³) nach unten verschieben, sodass er strenger wird.
- Beispiel: Eine Feuerungsanlage mit 1–2 MW Brennstoffwärmeleistung, die vorher einen Staubgrenzwert von 50 mg/Nm³ (bei 11 % O₂) hatte, liegt nach Umrechnung (Faktor 1,5) bei 75 mg/Nm³ (bezogen auf 6 % O₂). In der FAV 2019 sind aber häufig nur noch 50 mg/Nm³ (bei 6 % O₂) erlaubt. Damit ist der Wert tatsächlich strenger geworden.
Für Betreiber von Biomasse-Heizwerken heißt dies konkret, dass sie unter Umständen an ihren Entstaubungsanlagen (z.B. Zyklon, Gewebefilter oder Elektrofilter) nachrüsten müssen, um die neuen Grenzwerte einhalten zu können.

Intervalle der wiederkehrenden Messungen
Die FAV 2019 unterscheidet verschiedene Leistungsklassen bei den Feuerungsanlagen, was die Häufigkeit der umfassenden Messungen (auch „Überprüfungen“ genannt) angeht.
- 1–2 MW: Die Überprüfungen finden alle 3 Jahre statt (nach FAV 2019), während es davor (FAV 2011) alle 5 Jahre waren.
- 2–5 MW: Nach wie vor alle 3 Jahre.
- 5–20 MW: Ebenfalls alle 3 Jahre, allerdings ab 01.01.2025.
- 20–50 MW: Jährlich, statt zuvor alle 3 Jahre.
Für Ersatzkessel, die nur wenige Stunden im Jahr laufen (etwa zur Überbrückung bei Wartungen oder Störungen), gab es früher in der FAV 2011 eine Befreiung bei unter 250 Betriebsstunden pro Jahr. Diese Befreiung entfällt jedoch jetzt ab 1 MW. Das kann vor allem im kommunalen Bereich zu höheren Kosten für Messungen führen.

Besonderheiten bei Biomasseheizwerken und Fernwärme
Biomasseheizwerke oder Biomasseheizkraftwerke, die zur Erzeugung von Fernwärme betrieben werden, arbeiten oft mit unterschiedlichen Holzqualitäten (Hackgut, Pellets, Rinde, Sägeabfälle usw.). Daraus ergeben sich variable Brennstoffeigenschaften wie Brennstofffeuchte, Aschegehalt und Heizwert. Für die Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte aus der FAV 2019 ist es daher besonders wichtig, die Anlage richtig zu fahren und die Verbrennung möglichst sauber zu gestalten.
Emissionen im Fokus: Staub, Stickstoffoxide (NOx) und Kohlenmonoxid (CO) stehen ganz oben auf der Liste der zu überwachenden Schadstoffe.
Wartung und Instandhaltung: Wer die Filteranlagen vernachlässigt, riskiert Überschreitungen. Auch die Brennstoffaufbereitung (z.B. Trocknung, Siebung) kann die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten positiv beeinflussen.
Im Bereich Fernwärme kommt hinzu, dass die Anlagen besonders zuverlässig laufen müssen, weil ggf. große Netze mit vielen Abnehmern versorgt werden. Ein Ausfall kann hier schnell zu Versorgungsengpässen führen. Die neuen Messintervalle, die teils kürzer ausfallen, können Betreiber stärker fordern, ermutigen aber auch, die Anlage stets auf einem guten technischen Niveau zu halten.



Umgang mit Nichteinhaltung von Grenzwerten
Die FAV 2019 schreibt ausdrücklich vor, dass Fälle von Nichteinhaltung zu dokumentieren sind. Dies betrifft vor allem Situationen, in denen Messungen zeigen, dass bestimmte Emissionsgrenzwerte überschritten wurden. Der Gesetzgeber erwartet, dass Betreiber:
- Die Ursachen analysieren, z.B. ungeeigneter Brennstoff, Filterstörungen, falsche Anlageneinstellungen.
- Gegenmaßnahmen ergreifen, um schnellstmöglich wieder in den zulässigen Bereich zu kommen.
- Die Störung und die Reaktion darauf dokumentieren.
Für Betreiber von Biomasse-Heizanlagen kann das bedeuten, dass eine zu nasse oder stark verschmutzte Brennstoffcharge aus dem Brennstoffkreislauf genommen werden muss. Alternativ könnte eine Inspektion der Rauchgasreinigung (z.B. Elektrofilter) anstehen, falls dort ein Defekt vorliegt.
Technische Änderungen: Von Brennstoffzufuhr bis Rauchgasreinigung
Wer sich bereits länger mit dem Betrieb von Biomasse-Heizwerken oder anderen Kesselanlagen beschäftigt, weiß: Technische Modernisierungen können die Einhaltung der strengeren Grenzwerte deutlich erleichtern. So sorgen diverse Optimierungen in der Brennstoffzufuhr, der Luftstufung als auch der Kesseleinstellparamterter für stabilere Bedingungen im Brennraum. Das wiederum wirkt sich direkt auf die Emissionen von NOx und CO aus.
Häufige technische Anpassungen sind:
Verbrennungsregelung: Bessere Steuerung der Primär- und Sekundärluft. Dies geling vor allem durch Schulung des Betriebspersonals.
Brennstoffmanagement: Trocknung, Homogenisierung des Materials.
Rauchgasreinigung: Ergänzung oder Modernisierung von Filterstufen, z.B. dem Einsatz eines Rauchgaswäschers der sowohl das Rauchgas von Staub befreit und gleichzeitig mehr Energie aus den Abgasen durch Kondensation gewinnt.
Mess- und Überwachungstechnik: Kontinuierliche Rauchgasanalyse hilft, in Echtzeit auf Veränderungen zu reagieren.
Rolle von Kesselwärtern und Fachpersonal
Mit den neuen gesetzlichen Anforderungen ist deutlich geworden, dass Anlagenbetreiber qualifiziertes Personal benötigen, das den Betrieb professionell und verantwortungsvoll steuert. In diesem Zusammenhang wird oft auf die Kesselwärter verwiesen, die traditionell für die Überwachung der Anlage, die Bedienung und Wartung der Kesseltechnik verantwortlich sind.
Auch wenn hier nicht primär auf ein bestimmtes Ausbildungsformat verwiesen werden soll, ist klar: Fachkräfte mit fundiertem Know‒how in Verbrennungstechnik, Emissionskontrolle und Anlagenoptimierung sind für die Betreiber wertvoller denn je. Sie sorgen für:
- Rechtssicherheit, weil Grenzwerte und Vorschriften eingehalten werden.
- Betriebssicherheit, da Störungen schnell erkannt und behoben werden.
- Effiziente Fahrweise, was sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.
Gerade im Biomasse‒Heizwerk oder Fernwärme‒Bereich kann eine unzureichende Steuerung oder Fehlbedienung hohe Zusatzkosten verursachen, etwa durch zu hohen Brennstoffverbrauch, Emissionsstrafen oder Ausfälle.

Perspektiven für Betreiber: Warum sich frühzeitiges Handeln lohnt
Betrachtet man die gesetzlichen Übergangsfristen, wird klar, dass einige strengere Grenzwerte und Überprüfungsintervalle erst in ein oder zwei Jahren greifen. Dennoch ist es sinnvoll, sich bereits jetzt mit den kommenden Anforderungen zu beschäftigen. Wer frühzeitig investiert, kann:
- Kosten verteilen: Statt kurz vor Fristende in teure Nachrüstungen für Filtertechnik oder Steuerungen zu investieren, können Maßnahmen strategisch über einen längeren Zeitraum gestreckt werden.
- Schrittweise Verbesserungen vornehmen: Oftmals ist es sinnvoll, zuerst das betriebseigene Personal zu schulen, bevor man weitere Schritte bzgl. Rauchgasreinigung plant.
- Anlage effizienter machen: Jede Modernisierung bringt nicht nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, Grenzwerte einzuhalten, sondern kann auch die Effizienz steigern und damit Brennstoffkosten senken.
In einem Biomasseheizkraftwerk mag sich das beispielsweise in besserer Strom‒ und Wärmeerzeugung niederschlagen. Im Fernwärme‒Bereich profitieren die angeschlossenen Kunden von einem stabilen Betrieb und geringeren Ausfällen.
Neue Regelungen als Chance für moderne Anlagen
Die FAV 2019 und das EG‒K 2023 mögen auf den ersten Blick wie bürokratische Hürden wirken. Tatsächlich bieten sie jedoch die Möglichkeit, veraltete Anlagenstandards zu modernisieren und den Umweltschutz zu stärken. In Zeiten, in denen Biomasse und Fernwärme als zentrale Bausteine für eine nachhaltigere Energieversorgung gelten, wird der verantwortungsvolle Betrieb von Feuerungsanlagen gesellschaftlich immer wichtiger.
Zentrale Punkte der Neuerungen:
- Absenkung des Bezugssauerstoffgehalts bei festen Brennstoffen auf 6 % (statt 11 %).
- Häufigere und strengere Messintervalle, vor allem bei höheren Leistungen.
- Ausgedehntere Dokumentationspflicht (Aufbewahrung von Unterlagen für 6 Jahre).
- Umfassendere Einbindung älterer Dampfkessel in die FAV 2019 (Ab 110 °C als Abgrenzung).
Am Ende profitieren alle Beteiligten: Betreiber sichern ihren Anlagenbetrieb langfristig ab und leisten einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen. Wer sich damit auseinandersetzt, was eine saubere und effiziente Biomasse‒Heizwerksführung bedeutet, kann außerdem bei den Brennstoff‒ und Wartungskosten sparen und die Lebensdauer der Anlage verlängern.

Ausblick
Es ist zu erwarten, dass gesetzliche Bestimmungen in Sachen Umweltschutz und Emissionsgrenzwerte auch zukünftig weiterentwickelt und verschärft werden. Für Betreiber, Planer und Dienstleister im Bereich biogener Heizwerke, Fernwärme-Zentralen und Dampfkesselanlagen bleibt es daher unerlässlich, sich laufend über Neuerungen zu informieren.
Wer mit wachsendem Leistungs- und Dokumentationsumfang Schritt hält, wird feststellen, dass man nicht nur Rechtskonformität sicherstellen, sondern auch erhebliche betriebliche Vorteile erzielen kann: vom reibungslosen Betrieb bis hin zur Kostenersparnis. Die genannten Neuerungen sind somit weniger als Last zu verstehen, sondern vielmehr als Wegweiser zu modernen, umweltfreundlichen und zukunftsorientierten Feuerungsanlagen.
⸻
Abschließende Empfehlung: Ob es nun um den Einsatz effizienterer Filtertechniken, die lückenlose Dokumentation oder die regelmäßige Schulung von Personal geht – der Blick in die FAV 2019 und das EG-K 2023 zahlt sich aus. Eine fortlaufende Auseinandersetzung mit den geltenden Vorgaben verhindert unangenehme Überraschungen bei Behördenkontrollen, steigert das Ansehen des Anlagenbetreibers und trägt entscheidend zum Umweltschutz bei. Für alle, die sich tiefer in die Materie einarbeiten möchten, stellt das offizielle Verordnungsdokument eine unverzichtbare Lektüre dar.